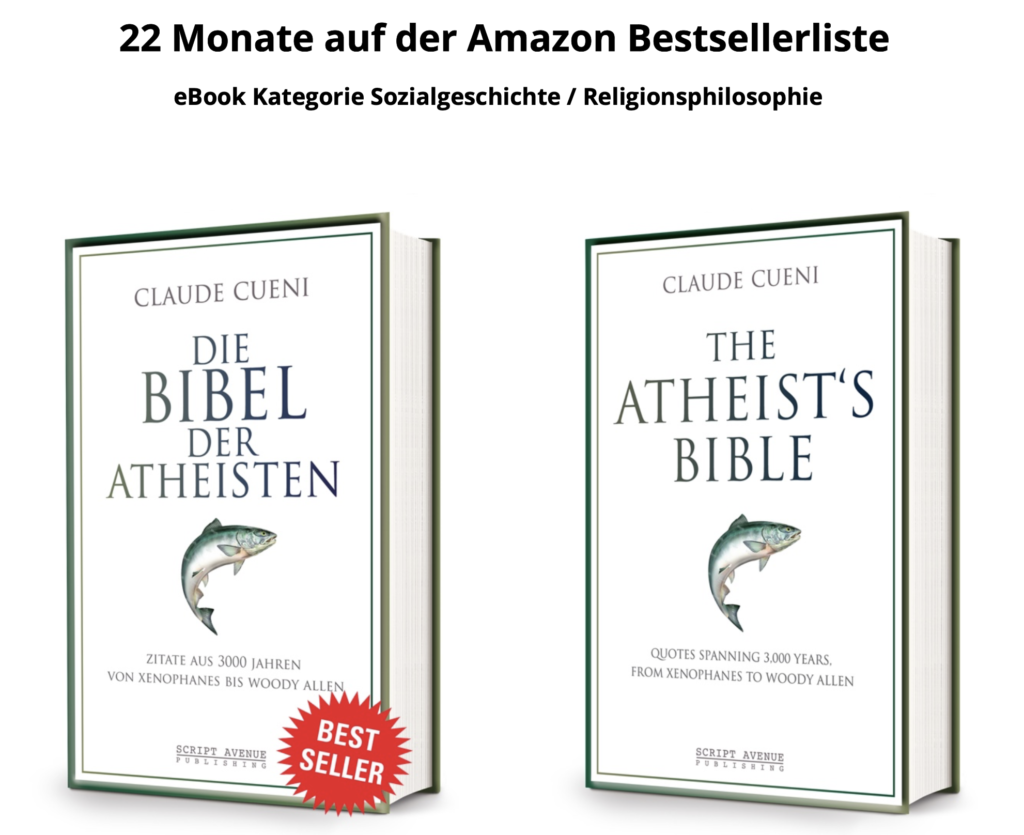Eine tropische Insel für «Carlos»?
Die Verbannung von Straftätern ins Ausland, um Kosten zu senken und Probleme auszulagern, hat eine lange Geschichte. Heute ist das kaum noch möglich. Dabei müsste man nur etwas kreativ werden.
«Über eines müsst ihr euch im Klaren sein: Ihr existiert nicht mehr für unser Land. Frankreich hat euch abgeschrieben, euch alle, ohne Ausnahme.» So begrüsst der Gefängnisdirektor im US-amerikanischen Gefangenendrama «Papillon» (1973) Henri Charrière, gespielt von Steve McQueen, Louis Dega (Dustin Hoffman) und die anderen Deportierten auf der Teufelsinsel in Französisch-Guayana. 2017 folgte ein Remake mit Charlie Hunnam und Rami Malek (dieser Film war besser als das Original, die Begrüssung dieselbe).
Während der Kolonialzeit war das Outsourcing von Straftätern in weit entfernte Kolonien nicht unüblich. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775‒1783) konnte Grossbritannien allerdings keine Häftlinge mehr in seine nordamerikanischen Kolonien abschieben. Als Alternative bot sich das 1770 vom britischen Kommandanten James Cook entdeckte Australien an. Allein zwischen 1788 und 1868 wurden über 162000 Straftäter nach Down Under ausgelagert. Die Gefangenen von Botany Bay und Port Arthur wurden auf Feldern, in Minen und im Strassenbau eingesetzt.
Frankreich deportierte von 1852 bis 1953 rund 70 000 politische Gegner und Schwerverbrecher in seine südamerikanische Strafkolonie im Dschungel von Französisch-Guayana. Viele Verurteilte starben an Hunger, Erschöpfung oder Krankheiten. Auch das Königreich Spanien lagerte seine Badboys in entfernte Kolonien aus, darunter auch auf die Philippinen. Im heutigen Jakarta befand sich das Straflager der niederländischen Kolonialherren, auf den Kapverden betrieben die Portugiesen Outdoorgefängnisse, in der libyschen Wüste hatten die Italiener ihre Strafkolonien.
Private Gefängnisse
Die Gründe waren im 18. und 19. Jahrhundert stets dieselben. Europäische Gefängnisse waren überfüllt, deren Unterhalt teuer und die Kolonien benötigten Arbeitskräfte für den Ausbau der kolonialen Infrastruktur. Die Deportierten waren Zwangsarbeiter, die man ohne Entgelt schuften und sterben lassen konnte. Und politische Gegner, die schickte man eh am liebsten ganz weit weg – das war schon in der römischen Antike so.
Aufgrund der hohen Kosten, die inhaftierte Straftäter in Hochpreisländern verursachen, wird seit Jahren über Einsparungen nachgedacht. Das Betreiben einer Strafanstalt ist ein 24-Stunden-Betrieb, das sind täglich drei Schichten zu jeweils acht Stunden. Und wenn nicht mehr die Bestrafung im Vordergrund steht, gelten westliche Standards, die um ein Vielfaches teurer sind als in der Dritten Welt.
Die USA haben sich deshalb in den 1980er-Jahren für etliche Privatisierungen von Gefängnissen entschieden. Gewinnorientierte Privatfirmen arbeiten in der Regel günstiger als aufgeblähte staatliche Verwaltungen. 1984 bekam die Corrections Corporation of America (CCA), heute CoreCivic, als erstes Unternehmen die Erlaubnis für die Übernahme einer Strafanstalt im südlichen Tennessee. Seitdem hat das Unternehmen expandiert und ist heute mit über 60 Anstalten einer der grössten Gefängnisbetreiber der USA. 17 000 Mitarbeiter betreuen 80 000 Straftäter. Die US-Bundesbehörden vergüten den Privaten die Übernahme von Häftlingen je nach Haftart, Standort und Sicherheitsstufe im Schnitt mit etwa 100 US-Dollar pro Tag. Das sind rund 3000 im Monat bzw. 36 000 im Jahr ‒ bei 80 000 Insassen über 2,8 Milliarden US-Dollar. Eine staatliche Verwaltung würde ein Vielfaches kosten. Nicht erstaunlich, dass in den USA die privatisierte Gefängnisindustrie boomt.
Seit längerem wird in den USA und in Europa über die Deportierung von Langzeitinsassen in kostengünstige Länder nachgedacht. Im Schnitt verlangen aufnahmewillige Haftanstalten in der Dritten Welt etwa 7200 US-Dollar pro Häftling im Jahr. In den meisten dieser Länder gilt ein Jahressalär von durchschnittlich rund 3600 US-Dollar als guter Lohn. Die Lebenshaltungskosten sind tief; bescheiden sind jedoch auch Unterbringung, Verpflegung, Hygiene und Sicherheitsmassnahmen.
Abschreckung statt Gefängnishotel
Die Kosten in der Schweiz variieren je nach Kanton, Art der Einrichtung und spezifischen Haftbedingungen. Bei uns haben wir zurzeit etwa 7000 Gefängnisplätze, der Ausländeranteil beträgt rund 70 Prozent, ihr Anteil an der ständigen Wohnbevölkerung liegt bei rund 27 Prozent. Gemäss Andreas Naegeli, Direktor der Anstalt Pöschwies – mit 400 Plätzen das grösste Gefängnis der Schweiz – kostet ein Inhaftierter im Normalvollzug 327 Franken pro Tag, das sind 9810 im Monat bzw. 117 720 im Jahr. Kommen noch erzieherische Massnahmen nach Jugendstrafrecht wie das Sondersetting bei Brian Keller («Carlos») hinzu, summieren sich die Gesamtkosten auf jährlich 350 400 (2013 bis 2015). Die damalige «Platzierungsmassnahme mit intensivpädagogischer Betreuung» beinhaltete die Unterbringung in einer 4-Zimmer-Wohnung mit Betreuung, Boxtraining als «sportpädagogischem Element» und intensiver Einzelbetreuung, um einen strukturierten Tagesablauf zu gewährleisten.
Zwischen 2018 und 2022 war Brian Keller, dem ein aussergewöhnliches Gewaltpotenzial attestiert wurde, für drei Jahre in Einzel- oder Sicherheitshaft. Der eigens für ihn umgebaute Hof kostete die Steuerzahler 1,85 Millionen Franken. Was hat es gebracht? Vor einem halben Jahr unterstützte die Stadt Zürich einen Box-Workshop des Kollektivs #BigDreams mit Brian Keller mit 25 000 Franken. Sie stufte den Event als künstlerisches Projekt ein. Schreibt «Carlos» demnächst Gedichte? Im Juni 2025 wurde Keller erneut verurteilt, diesmal zu 45 Monaten Haft.
Es gehört zum rot-grünen Narrativ, wonach jeder Mensch im Grunde genommen gut und wenn doch nicht so gut, so wenigstens resozialisierbar ist. Anwälte und Richter, die seit Jahrzehnten dieselbe Kundschaft haben, würden hier widersprechen. Es ist keine Frage von links oder rechts, sondern eine Frage der Erfahrung. Nicht alle Menschen haben einen friedlichen Kern, nicht alles lässt sich mit Geld lösen. Auch nicht, wenn es das Geld der andern ist.
Verstoss gegen EMRK
Was wären die Alternativen? Outsourcing, zum Beispiel auf die Philippinen? Das Land besteht aus 7641 Inseln, etwa 2000 davon sind bewohnt. Private verkaufen über Plattformen wie Island-Seeker ihre Inseln. Dao Island (47,9 Hektaren) bei Busuanga / Palawan ist als Freehold verfügbar, die Preise liegen zwischen 250 000 und 1,8 Millionen US Dollar, also unter den Kosten für den umgebauten «Privathof» von Brian Keller. Seit 1987 verbietet die philippinische Verfassung jedoch den Erwerb von Land durch ausländische Privatpersonen oder ausländische Staaten. Im tropischen Paradies wäre der Erwerb nur durch eine philippinische Kapitalgesellschaft mit mehrheitlich philippinischem Besitz denkbar (60 Prozent). Das ist auch in Thailand und anderen asiatischen Ländern so. Doch wie üblich hat fast jedes Gesetz ein Schlupfloch: Ausländische Botschaften, Konsulate oder Kulturzentren können für 25 oder 50 Jahre Land oder Inseln pachten. Die USA schliessen für ihre Militärstützpunkte und Forschungseinrichtungen im Wilden Westen Asiens solche Verträge ab. Gemäss bilateralen Militärabkommen haben sie Zugang zu ihren Basen, aber kein Eigentum am genutzten Land.
Doch auch was auf den Philippinen juristisch möglich ist, wäre bei uns kaum durchsetzbar. Die Schweiz darf ihre Bürger nicht ausser Land bringen, wenn sie unter schlechteren Bedingungen ihre Strafe absitzen müssten. Der Schweizer Hotelstandard müsste auch in der tropischen Inselwelt der Taifune gelten. Es wäre auch ein Verstoss gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und widerspräche dem Resozialisierungsgebot im Schweizer Strafvollzugsrecht. Der Puddingparagraf der Verhältnismässigkeit würde etlichen Anwälten Vollbeschäftigung garantieren. Doch auch hier gibt es Schlupflöcher. Mit der Zustimmung des philippinischen Kongresses und Präsidenten wäre ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Schweiz und den Philippinen möglich. Die Insel bliebe philippinisches Hoheitsgebiet, Schweizer Beamte dürften nur Gaststatus haben.
Kein «Swiss Guantánamo»
Auch in Kanada, den USA, Panama, Fidschi, Griechenland, Tansania und Indonesien sind Inseln nach demselben Prinzip zu haben. Eine Insel für «Carlos» wäre also nur möglich, wenn er eine Haftverbüssung unter freiem Himmel einer Hochsicherheitszelle vorzieht. Es wäre dann keine Gefängnisinsel, kein «Swiss Guantánamo», wie einige Medien aufschreien würden, sondern ein freiwilliges therapeutisches Wohnprojekt für Straftäter mit hohem Rückfallrisiko – betrieben von einer von der Schweiz finanzierten NGO.
Einfacher zu realisieren wäre das Outsourcing auf die philippinische Gefängnisfarm «Iwahig Prison and Penal Farm». Sie liegt auf der Insel Palawan, in der Nähe der Hauptstadt Puerto Princesa. Auf dieser riesigen Farm ohne Mauern leben rund 5000 verurteilte Straftäter. Die Hälfte hat sich dank guter Führung einen Sonderstatus verdient. Sie arbeiten als Selbstversorger in der Landwirtschaft und verbringen die Nächte in frei zugänglichen Schlafsälen. Einzelne leben hier mit Familienangehörigen zusammen. Auf dem Gelände gibt es deshalb eine Schule, Läden und Freizeitangebote. Es gibt kaum Fluchtversuche, die Rückfallquote ist gering, einige bleiben nach Verbüssung ihrer Strafe mit ihren Angehörigen auf der Farm.
Würde «Carlos» das Farmerleben einer grauen Zelle vorziehen? In der Heimat der Box-Ikone Manny Pacquiao kann man übrigens auch ohne Lizenz an Boxkämpfen teilnehmen. Und wenn man ihm einen Internetzugang garantieren würde, könnte er die Zahl seiner Followers massiv erhöhen und so Geld verdienen.
Ungewöhnliche Situationen verlangen manchmal ungewöhnliche Ideen.