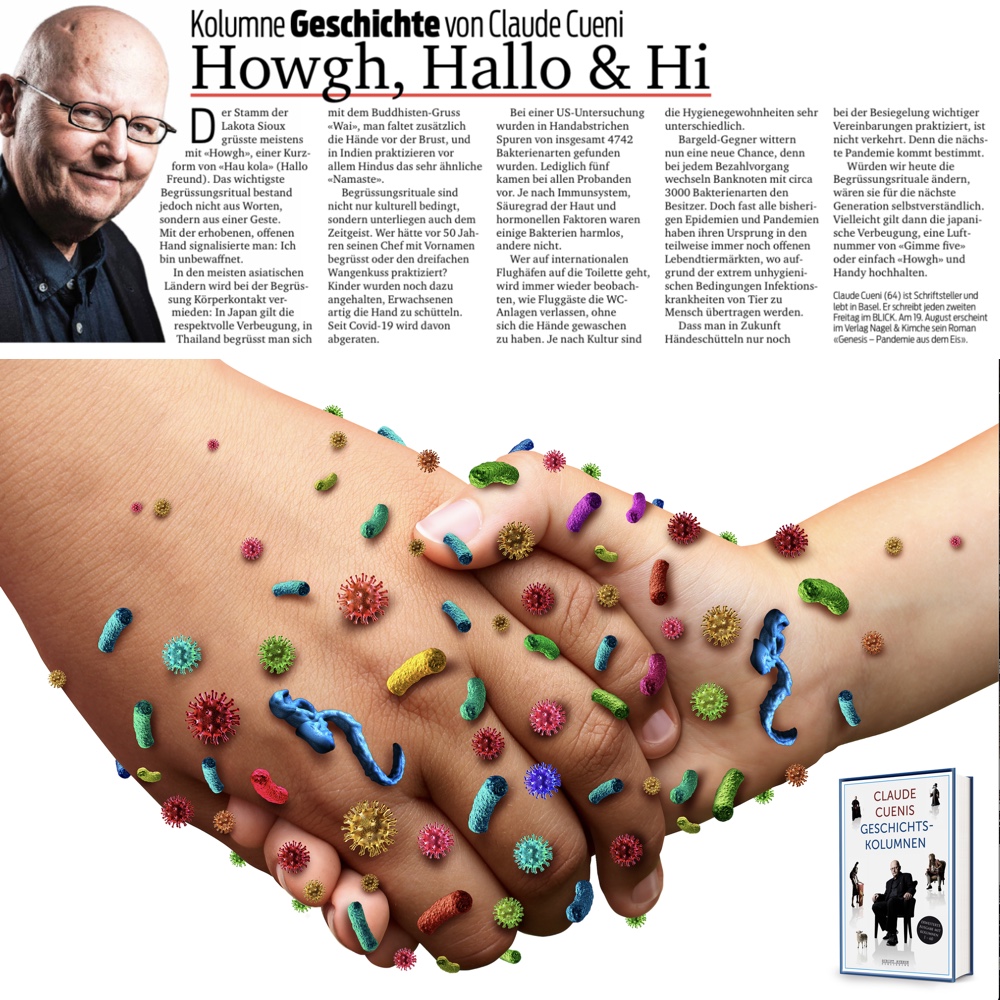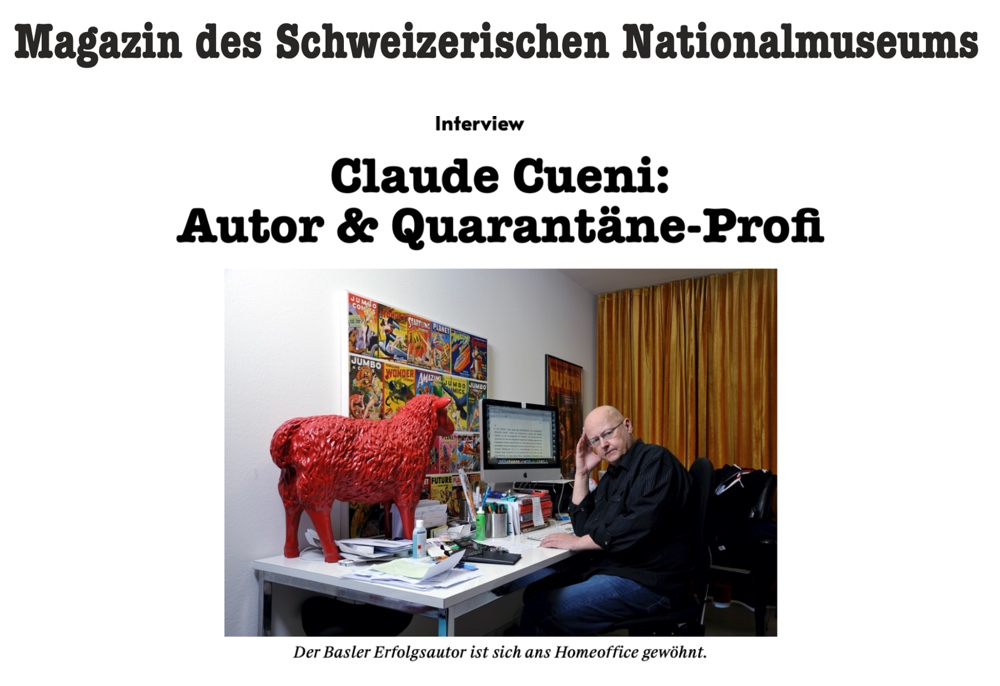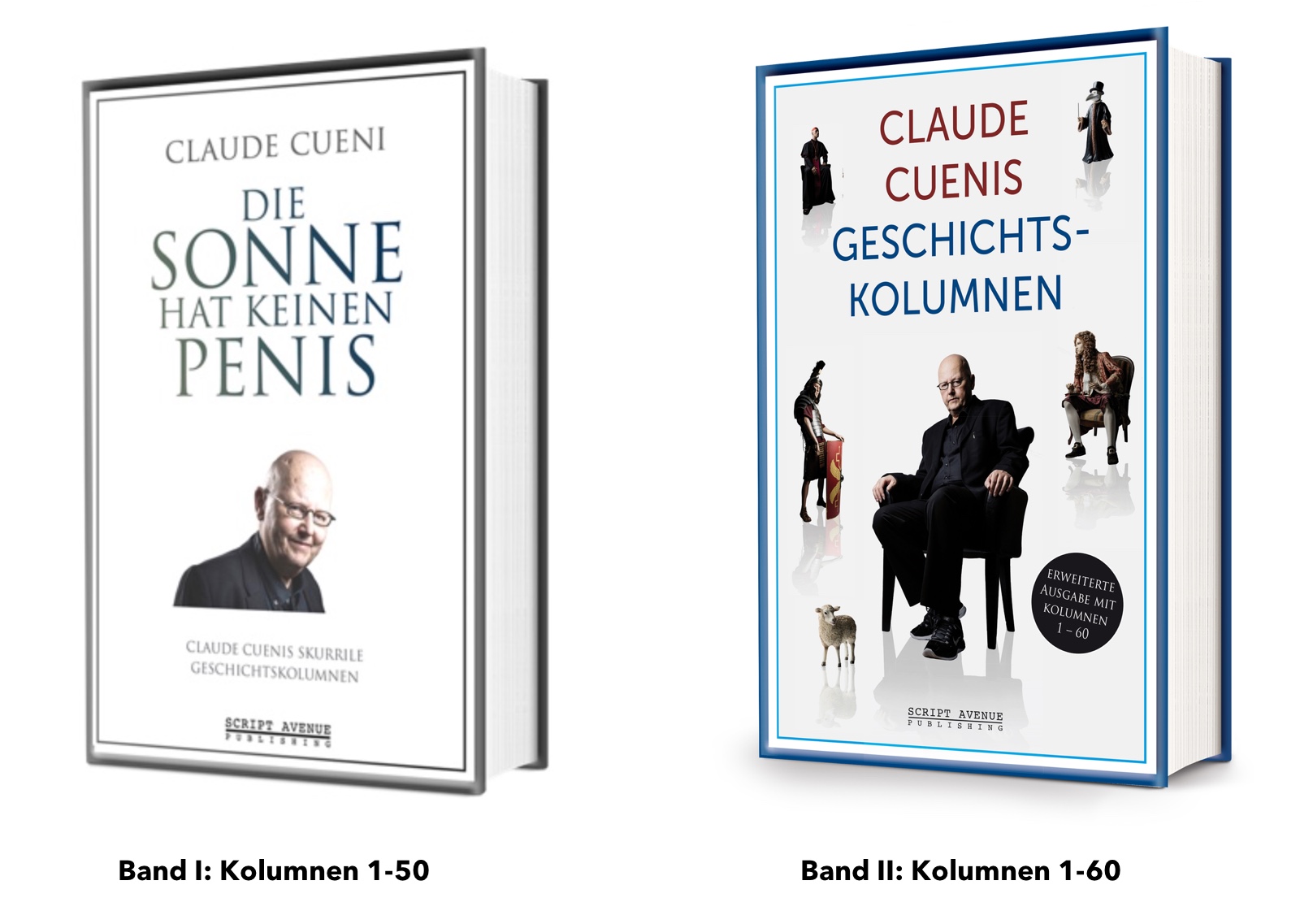In Sibirien ist es erstmals seit 75 Jahren zu einem Milzbrand-Ausbruch gekommen. Ein Kind ist an der von Anthrax-Bakterien verursachten Erkrankung gestorben. Insgesamt 23 Menschen wurden infiziert.
Das Leben von Nenzen, einem indigenen Volk im Nordwesten Sibiriens, dreht sich um Rentiere. Mit ihren Herden ziehen die Nomadenfamilien durch die menschenleeren, flachen Weiten der Tundra von einer Weide zur nächsten. Ihre Häuser und traditionelle Kleidung machen sie aus Rentierleder.
Im Winter gibt es keinen besseren Schutz vor arktischem Frost. Das Fleisch der Rentiere wird roh und gekocht gegessen. Ausgerechnet diese Nähe zu den Tieren machte die Hirtenfamilien anfällig für eine gefährliche Infektion, die von Huftieren übertragen wird, den Milzbrand – auch bekannt unter der Bezeichnung Anthrax.
Auf der nordsibirischen Halbinsel Jamal wurde im Juli der erste Ausbruch dieser Krankheit seit dem Jahr 1941 registriert. Mehr als 2300 Rentiere sind bereits daran gestorben. Das gefährliche Bakterium wurde auch auf Menschen übertragen. Ein zwölfjähriger Junge ist am Montag an Darmmilzbrand gestorben. Das war offenbar die Folge des Verzehrs von verseuchtem Fleisch.
Insgesamt rund 90 Menschen wurden in die Krankenhäuser der Region gebracht. Bei 23 von ihnen wurde Milzbrand diagnostiziert. Laut Ärzten handelt es sich in den meisten Fällen um eine Krankheitsform, die durch Hautkontakt zu den Tieren übertragen wird und Geschwüre an der Haut verursacht. Die zweite Form, an der auch der Junge gestorben ist, ist gefährlicher. In diesen Fällen treten bei den Erkrankten blutiger Durchfall und Erbrechen auf, das Sterberisiko ist höher. Die Kranken werden mit Antibiotika behandelt.
Das Ausbrechen der Krankheit begann in Sibirien nach einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Im Juni und Juli kletterten die Temperaturen am Polarkreis auf 35 Grad. Anfang Juli meldeten die am See Jarojto lebenden Hirten, dass bei ihnen Dutzende und dann Hunderte Rentiere gestorben sind. Zunächst machten sie die direkte Einwirkung der Hitze dafür verantwortlich.
Doch das Tiersterben hörte nicht auf, als die Temperaturen zurückgingen. Am 23. Juli wurde in dem lokalen sozialen Netzwerk „Vkontakte“ ein Hilfeaufruf gepostet: „In der Nomadensiedlung am See Jarojto, bestehend aus zwölf Häusern, sind 1500 Rentiere gestorben, Hunde sind verendet. Überall stinkt es, Kinder haben Hautgeschwüre.“
Das Bakterium Bacillus anthracis wurde nachgewiesen
Die Menschen seien bis jetzt nicht evakuiert worden. In den Proben, die Behörden bei Kadavern genommen und in Labore geschickt haben, wurde der Milzbranderreger, das Bakterium Bacillus anthracis, gefunden.
Russische Experten gehen davon aus, dass es tatsächlich die große Hitze gewesen sein könnte, die zu dem Ausbruch der Infektion führte. Die Sporen von Bacillus anthracis können jahrzehntelang in Kadavern überleben, die im Permafrost begraben sind. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen führten zum Auftauen des Bodens, sodass die Bakterien wieder zum Leben erweckt wurden. Sie konnten an die Erdoberfläche gelangen, dort steckten sich erste Tiere an.
„Der Klimawandel spielt hier eine große Rolle“, erklärte Viktor Malejew, ein leitender Epidemiologe der russischen Verbraucherschutzbehörde, dem britischen Radiosender BBC. „Im Boden wurden vor Jahren tote Tiere begraben. Doch aufgrund des Permafrosts wussten wir lange Zeit nicht, was sich dort alles verbirgt.“
Solche Orte mit alten verseuchten Tierkadavern können nach Einschätzung von Experten auch noch nach 100 Jahren gefährlich sein. Der globale Klimawandel und das dadurch verursachte Auftauen des Permafrostbodens haben also mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Krankheitsausbruch geführt.
Spezialeinheit der Armee verbrennt Tote Rentiere
Nachdem den regionalen Behörden das Ausmaß der Gefahr bewusst geworden war, wurde in der betroffenen Region Quarantäne ausgerufen. Hirtenfamilien wurden evakuiert, sie mussten alle ihre Habseligkeiten in der Tundra lassen. „Stellen Sie sich vor – in einem Moment haben die Menschen alles verloren, den ganzen Besitz, ihre Häuser und Rentiere“, erzählte eine Bewohnerin im regionalen Fernsehen. Nun bekommen die betroffenen Familien Hilfe von Behörden und auch privaten Spendern.
Eine Spezialeinheit der russischen Armee, die für den Schutz vor biologischen Waffen zuständig ist, wurde in die Tundra geschickt. Das russische Fernsehen zeigte Soldaten in ABC-Schutzkleidung, die sich darauf vorbereiteten, mit Anthrax verseuchte Kadaver von Rentieren zu verbrennen.
Ein General erzählte, er wisse nicht, wie lange es noch dauern könne, bis das ganze Ausbruchsareal desinfiziert ist. Tote Rentiere seien im Umkreis von zehn Kilometern um die Nomadensiedlung zu finden. Den Hirten war ja nichts anderes übrig geblieben, als die Gefahrenzone zu verlassen und die Kadaver in der Tundra liegen zu lassen. Nun werden die Soldaten sie alle aufspüren und entsorgen müssen.
40.000 Rentiere wurden geimpft
Die Gegend wurde vom Militär abgesperrt. Vorsorglich sind überdies Impfstoffe für Mensch und Tier in die Region gebracht worden. Nach offiziellen Angaben der Behörden wurden bislang schon rund 40.000 Rentiere geimpft.
Außerdem will man bei dieser Gelegenheit auch nach jenen Orten suchen, an denen vor Jahrzehnten verendete Tiere begraben wurden. Auch dort könnte es theoretisch zu einer Freisetzung von Milzbranderregern zu einem späteren Zeitpunkt kommen.
Milzbrand ist in erster Linie eine Krankheit von Tieren. Sie kann aber auch vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Die Übertragung von einem Menschen zum anderen ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
Das todbringende Bakterium ist im 20. Jahrhundert in Militärlabors sehr gut erforscht worden, da es grundsätzlich auch als biologische Waffe eingesetzt werden kann. Für einen derartigen Angriff würde man Bakterien in der Luft als Aerosol versprühen. Sie können dann in die menschlichen Atemwege eindringen und zu Milzbrand führen.
© Axel Springer SE. Alle Rechte vorbehalten.