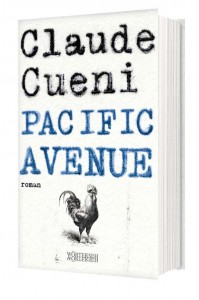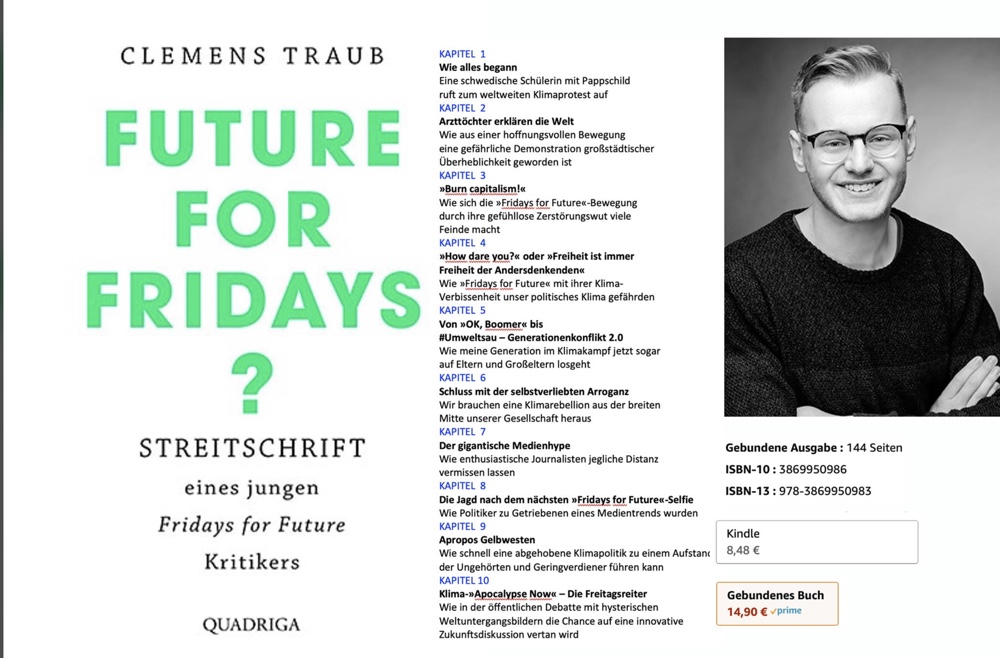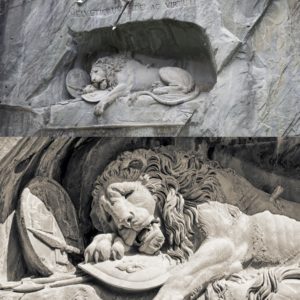Skandal im Vatikan Hunderte Millionen an Hilfsgeldern für Bedürftige wurden in Hollywoodfilme, Bierbrauereien oder Luxusimmobilien für die Reichsten investiert: Die Römische Kurie wird von der grössten Finanzaffäre der letzten 30 Jahre erschüttert. Dass sie aufgedeckt wurde, ist auch das Verdienst des italienischen Enthüllungsjournalisten Emiliano Fittipaldi.
Oliver Meiler, Rom
«Cupolone», «grosse Kuppel», so nennen die Römer das Dach von Sankt Peter, sie sagen es mit liebevollem Unterton. Die Kuppel spannt sich wie ein Gewölbe über ihre Stadt. Kein weltlicher Bau in Rom darf höher und erhabener sein als Michelangelos Werk, so wollten es die Päpste. Das vermeintlich Heilige sollte über dem Profanen thronen, die Kirche über dem Staat. Moralisch überlegen. Das war natürlich immer schon ein Scherz, die Geschichte ist Zeugin. Aber die architektonische Entrückung ist geblieben.
Ganz besonders eindrucksvoll wirkt das Panorama der Vatikanstadt, dieses kleinen Staates im Staat, ein paar Hundert Einwohner, von Mauern umgeben, wenn man von der Tiberbrücke Umberto I. hinüberschaut. Ist nicht Pandemie, stehen jeden Abend Fotografen auf der Brücke und warten auf das Dämmerrot, den Feuerhimmel über San Pietro. Wenn noch schwarze Wolken den Cupolone umspielen, ist das Drama perfekt, dann entstehen Fotos für Zeiten wie diese.
«Im Vatikan wird gerade der grösste Finanzskandal der letzten 30 Jahre verhandelt», sagt der Investigativjournalist Emiliano Fittipaldi, ein berühmter Enthüller vatikanischer Unheiligkeiten, 46 Jahre alt, Neapolitaner. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was an Verdachtsmomenten und Ermittlungsthesen schon zirkuliert, ist diese Affäre grösser als Vatileaks 1 (2011) und Vatileaks 2 (2015), die Skandale um die gefrässige Kurie und die Wirrungen bei der Bank des Vatikans. Von Vatileaks 1 heisst es, es habe dazu beigetragen, dass Papst Benedikt XVI. zurücktrat. Bei Vatileaks 2 war Fittipaldi unfreiwillig Hauptfigur, in der Rolle des Aufdeckers. Jetzt aber schreiben die Medien von der «grossen Plünderung des Vatikans», vom «Überfall in der Kurie».
«Komisch, nicht?»
Vor einigen Wochen warf Franziskus einen Kurienkardinal raus, der so mächtig war, dass er Hunderte Millionen Euro aus dem Spendentopf der katholischen Kirche verschieben konnte, fast nach Belieben, mit dem Plazet der Päpste natürlich.
«Dieser Topf war extra bilancio», sagt Fittipaldi, ohne Bucheintrag. Das hat er vor einem Jahr aufgedeckt. Der Peterspfennig für die Armen? In den vergangenen zehn Jahren flossen Millionen in Luxusimmobilien in London, in Fonds auf Malta und Luxemburg, auch in Filmproduktionen, die nichts mit dem Vatikan zu tun hatten. 3,3 Millionen Euro für «Men in Black». 1 Million Euro für «Rocketman», den Film über das Leben des Sängers Elton John. Elton John?
«Komisch, nicht?», sagt Fittipaldi, er hat alle Zahlen im Kopf, jeden Namen, jede Affäre, sie brechen wie ein Strom aus ihm heraus. «Die Diskrepanz zwischen dem, was man gemeinhin vom Vatikan erwartet, und dem, was wirklich ist, ist immens.»
Er hat das schon in allen Facetten erlebt. Zu seinem Fachgebiet kam er eher zufällig. Fittipaldi hat Literatur studiert und dann einen Masterkurs in Journalismus absolviert. Als er 2007 von Neapel nach Rom zog, wies ihm sein neuer Arbeitgeber, das Nachrichtenmagazin «L’Espresso», die Schnittstelle zwischen Politik und organisiertem Verbrechen zu. Macht und Mafia, das ganz grosse Feld, es wurde bald noch grösser. «Wenn du in Rom der Spur des Geldes folgst, landest du immer schnell auf der Via della Conciliazione.» So heisst die Allee, die zum Petersplatz führt. «Unweigerlich.»
Fittipaldi ist ein schmaler, grosser Mann, detailverhaftet, beim Zuhören reisst er seine Augen weit auf. Er sitzt jetzt wieder oft in Fernsehstudios und erzählt unfassbare Geschichten von finanziellen Machenschaften, wie aus billigen Thrillern. Geschichten von Gier und Geiz, von Bruderkriegen unter Kurienkardinälen, von schillernden Figuren aus der Halbwelt, von Spionen und Mätressen. «Die Kirche ist eben eine sehr irdische Institution, eine Männerwelt. Geld, Macht, Sex. Das beschäftigt die Herrschaften schon ungemein.» Er sagt das ganz nüchtern, fast emotionslos. «Ich gehe mit technischer Methodik an die Arbeit, als wäre die Kirche eine Institution wie jede andere.» Fittipaldi ist katholisch aufgewachsen, aber zur Messe geht er schon lange nicht mehr. Manchmal spielt man ihm vertrauliches Material zu, dann prüft er die Quellen, schaut sich die Fakten an, die Beweise dazu und schreibt sie auf, neuerdings für die Zeitung «Domani», deren Vizedirektor er ist.
Die italienischen Medien nennen den aktuellen Fall «Caso Becciu». Angelo Becciu ist ein sardischer Kardinal aus Pattada, einem Ort in der Provinz Sassari, arme Verhältnisse, 72 Jahre alt. Ende September fiel er in Ungnade wegen des Verdachts auf Veruntreuung. Abrupt, wie er fand, völlig unfair. «Der Papst begeht einen Fehler», sagte Becciu, als ihm Franziskus nach einer kurzen und angeblich lauten Unterredung alle Rechte und Privilegien des Kardinalsstands entzogen hat. Nur das Purpurrot darf er behalten, die Farbe des Amtes. «Dabei würde ich doch für den Papst sterben.» Das erste Interview nach dem Rauswurf gab Becciu Emiliano Fittipaldi, und das war nicht selbstverständlich: Die zwei verbindet eine lange, durchwachsene Geschichte.
Becciu war von 2011 bis 2018 Substitut des Staatssekretariats, der zentralen Regierungsbehörde des Vatikans, Herz der römischen Kurie. Substitut hört sich nach zweiter Reihe an. Doch Becciu, der davor lange Jahre als Apostolischer Nuntius den Heiligen Stuhl an vielen Orten der Erde vertreten hatte, war ein sehr mächtiger Mann. Die Nummer drei im Vatikan, wenn man so will, nur der Papst und der Staatssekretär standen über ihm. «Er kennt alle Geheimnisse und Winkel des Vatikans», sagt Fittipaldi, «er ist ein Machtmensch, ein versierter Stratege.» Noch haben die Ermittler des Vatikans keine Anklage gegen Becciu erhoben. Fürchtet man ihn? Oder sind die Beweise zu dünn?
Im Staatssekretariat gab es damals eine Kasse, über deren Inhalt niemand Bescheid wissen sollte. Das Geld darin kam vom «Obolus von Sankt Peter», dem Peterspfennig. Jeden 29. Juni bittet der Papst um Spenden für die Bedürftigsten. Der Deal mit den Gläubigen ist: Ihr gebt mir das Geld, und ich verteile es an die Armen. So war das aber nie. Die Spende floss jeweils in die «cassa» im Staatssekretariat. Als Angelo Becciu übernahm, lagen 750 Millionen Euro in der Kasse, etwa 7 Prozent des gesamten vatikanischen Vermögens, das auf 11 Milliarden Euro geschätzt wird. Das ist eine vage Schätzung. Niemand weiss, wie hoch zum Beispiel der Wert der vielen Immobilien im Besitz der Kirche ist. Allein in Rom sind es Hunderte, ganze Palazzi.
Die 750 Millionen in der Kasse des Staatssekretariats aber waren bar, sofort einsetzbar. Das Geld sollte noch etwas mehr werden. Das wäre an sich nicht verwerflich gewesen, hätte sich die Kirche bei ihren Anlagen von den moralischen Standards leiten lassen, die sie von allen einfordert. Doch Becciu war offenbar der Gordon Gekko der Kurie, wie die Hauptfigur im Film «Wall Street» heisst. 2012 hatte er die Idee, 200 Millionen in eine Ölplattform im Meer vor Angola zu pumpen, ein befreundeter angolanischer Erdölindustrieller wollte sie bauen.
Angelo Becciu war als Nuntius lange Zeit in Luanda stationiert gewesen, so hatte man sich kennen gelernt. Die Idee der Plattform wurde verworfen. Die Investition sei nicht sicher genug gewesen, sagte Becciu.
Abgeraten hatte ihm Enrico Crasso, italienischer Financier, wohnhaft in der Schweiz, früher Angestellter der Credit Suisse, der Hausbank des vatikanischen Staatssekretariats. «Das ist kein Zufall», sagt Fittipaldi, «die Verbindung zur Schweiz hat Tradition.» Als sich in Italien 1929 Kirche und Staat trennten, sahen die Lateranverträge eine beträchtliche Entschädigungssumme für den Vatikan vor. 100 Jahre später erfuhr man, dass die Kirche das Geld sofort in die Schweiz brachte, auf Nummernkonten. «Das ist tief drinnen in ihrer Kultur.»
Anstelle der Ölplattform in Angola rückte eine Immobilie in London ins Interesse des Vatikans: Sloane Avenue 60, ein mächtiges kubisches Gebäude mit viel Glas und rotem Backstein, das früher dem Warenhaus Harrods gehörte. Mitten in Chelsea, beste Lage. Der Makler Raffaele Mincione, der das Luxusobjekt anbot, schwärmte Becciu vor, dass sich darin tolle Wohnungen bauen lassen würden, die man dann an vermögende Kunden verkaufen werde. Er kenne da einen grossartigen Innendekorateur.
Und so investierte der Substitut 200 Millionen Euro aus der «cassa» mit dem Geld für die Ärmsten in eine Luxusimmobilie für die Reichsten. Dafür gab es aber nur einen Teil des Gebäudes, es war ein hoch spekulatives und riskantes Geschäft.
Wahrscheinlich wäre die Geschichte nie aufgeflogen, hätte der Brexit nicht das Britische Pfund in die Tiefe gezerrt – und den Londoner Immobilienmarkt gleich mit. Der Vatikan verlor viel Geld, auch weil er viel zu hohe Kommissionen an die Makler und Mittler entrichtete. Ermittler des Papstes suchen jetzt nach Beweisen für ihre Vermutung, dass auch Kirchenfunktionäre im grossen Stil Geld unterschlagen haben. Bei einem Ex-Angestellten des Staatssekretariats fand die Guardia di Finanza Münzen und Medaillen im Wert von 2 Millionen Euro, dazu 200’000 Euro bar in einer Schuhschachtel.
Becciu war ein Mann der alten Nomenklatura, noch berufen von Benedikt XVI., und er war ein treuer Wegbegleiter von Kardinal Tarcisio Bertone, dem langjährigen Staatssekretär, der Symbolfigur des verschwenderischen Umgangs der Kurie mit dem Geld der Gläubigen. Auch die Geschichte Bertones deckte Fittipaldi auf. 2015 wurden ihm Dokumente zugespielt, die zeigten, dass der hohe Prälat mit Geld aus dem katholischen Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom das Penthouse aufhübschte, in dem er bis heute lebt.
Eine halbe Million für den Umbau, vor allem die Dachterrasse soll sehr schön geworden sein. Fittipaldi machte aus der Enthüllung sein Buch «Avarizia», Geiz. Ein Bestseller: 200’000 verkaufte Exemplare, übersetzt in 20 Sprachen. Zusammen mit dem Buch «Via Crucis» des Journalisten Gianluigi Nuzzi, der ebenfalls auf geleaktes Material zurückgreifen konnte, bildete «Avarizia» die Grundlage für Vatileaks 2.
Pressefreiheit? Nicht hier
Dem Vatikan gefiel das gar nicht. Becciu war besorgt, dass sein Kartenhaus ins Wanken gerät. Und Franziskus, der in den Jahren davor versucht hatte, die Missstände in der Kurie aufzuräumen, und dafür ein Sekretariat für Wirtschaft einrichtete, ermahnte jene, die die schmutzigen Geheimnisse ans Licht brachten: die Mitarbeiter der vatikanischen Aufsichtsbehörde, die das Material weitergereicht hatten, und die Journalisten, die es für ihre Bücher nutzten. Auch Fittipaldi und Nuzzi sollte der Prozess gemacht werden hinter dem dicken Gemäuer. Der Vorwurf: Veröffentlichung geheimer Akten. Darauf stehen im Vatikan vier bis acht Jahre Haft. Pressefreiheit? Etwas für die anderen.
Nuzzi wies die Vorladung zurück. Fittipaldi aber ging hin, setzte sich vier Stunden lang auf die harte Holzbank im vatikanischen Tribunal. «Das war stressig», sagt er. «Ich kämpfte um meinen Ruf, sie wollten ihn besudeln, das war ein politischer Prozess.»
Aber es war auch aufregend. Die Welt schaute zu, alle grossen internationalen Sender schickten Kamerateams. Das Buch lief danach hervorragend. Sechs Monate später wurden die italienischen Reporter freigesprochen, weil der Vatikan kein Recht hatte, über sie zu richten. Das war absehbar gewesen, doch der Kirchenstaat ist in solchen Dingen oft erstaunlich dilettantisch, fast schon weltfremd.
Es vergingen zwei Jahre, die Wellen legten sich. Dann ernannte Franziskus Angelo Becciu zum Kardinal und Präfekten der Heiligenkongregation. Eine Promotion, hätte man meinen können. Doch bald wurde klar, dass der Papst ihn befördert hatte, um ihn loszuwerden. Weg vom Staatssekretariat und den Geschäften, rüber ins unverfänglichere Dikasterium der Seligen und Heiligen. Eine erste Entmachtung.
Der Job von Becciu im Staatssekretariat ging an Edgar Peña Parra, einen venezolanischen Erzbischof und engen Vertrauten des Papstes. Der erbte den Investitionsflop an der Sloane Avenue. Doch statt die Anteile zu verkaufen, kaufte Peña Parra noch den Rest dazu, das gesamte Investment des Vatikans betrug nun etwa 350 Millionen Euro. Nie zuvor hatte die Kirche so viel Geld investiert. Und nie so abenteuerlich.
Makler Mincione wurde mit 40 Millionen Euro abgefunden, aus der Schatulle mit dem Peterspfennig. Neu verkehrte der Vatikan nun mit einem schillernden Geschäftsmann, einem gewissen Gianluigi Torzi, der in seiner Karriere oft schon Probleme mit der italienischen Justiz gehabt hatte: etwa wegen betrügerischen Konkurses. Doch im Vatikan kam es niemandem in den Sinn, mal kurz nachzuschauen, mit wem man es zu tun hatte. «Es hätte gereicht, wenn sie Torzis Namen gegoogelt hätten», sagt Emiliano Fittipaldi. Und so sass die Kirche mit ihren 350 Millionen Euro plötzlich im Boot mit diesem Torzi. Im Vertrag inbegriffen: ein Handgeld von 15 Millionen für den Broker. Als sie es merkten, war es schon zu spät.
Der «Fall Becciu» ist also auch ein «Fall Peña Parra» geworden. «Die Geschichte hat zwei Halbzeiten, wie ein Fussballspiel», sagt Fittipaldi. In der ersten spielte der Sarde, die zweite läuft noch, es spielt der Venezolaner. Noch ist nicht klar, in welcher Halbzeit der Vatikan am Ende höher verliert – in der ersten oder in der zweiten.
Der Papst hat dem Staatssekretariat mittlerweile die «cassa» weggenommen. Die Finanzen kommen jetzt alle unter ein Dach, Transparenz und Kontrolle sind das Ziel. «Zum ersten Mal handelt der Vatikan aus eigener Initiative», sagt Fittipaldi. Er spricht von «Vatikanopoli», der Begriff ist angelehnt an «Tangentopoli», wie man in den Neunzigern den Korruptionsskandal in Mailand nannte, den die italienische Justiz mit einer Grossoperation trockenlegte. «Das ist schon mal ein gutes Signal, aber noch keine Garantie für Erfolg.» Erst wenn auch «fedelissimi» des Papstes, engste Vertraute, hart geprüft würden, könne das gelingen.
Gegen Becciu ploppen immer neue Vorwürfe auf. Er soll seine drei Brüder begünstigt haben, heisst es. Einer von ihnen ist Schreiner, er durfte Kirchen renovieren in Ländern, in denen Angelo Botschafter war. Die Rechnungen gingen nach Rom. Ein anderer soll 700’000 Euro für seine karitative Organisation auf Sardinien erhalten haben, die mit der örtlichen Diözese arbeitete. Der dritte Bruder, ein Psychologieprofessor, der nebenbei Bier braut, bekam Geld vom angolanischen Ölindustriellen, dem Freund des Kardinals: 1,5 Millionen Euro. Die Firma nannte er Angel’s S.r.l., Engel GmBH – eine Verneigung vor Bruder Angelo?
Ein unsäglicher Verdacht
Und dann gibt es noch die Geschichte von Cecilia Marogna, einer Managerin aus Cagliari, Sardin, wie Becciu, 39. Eine hübsche Frau, sehr aktiv in den sozialen Medien, was nicht so recht zu ihrem Berufsprofil passen will. Marogna erhielt mehrere Hunderttausend Euro aus dem Staatssekretariat für angeblich geheime Missionen. Etwa für die Verhandlungen zur Befreiung einer kolumbianischen Ordensschwester, die in Mali von Jihadisten verschleppt worden war. Marogna soll nämlich auch eine Paralleldiplomatin sein, perfekt vernetzt mit in- und ausländischen Geheimdiensten. Einen schönen Teil des Geldes aus Rom gab sie für Schmuck, Parfüm und teure Möbel aus, für Kleider, Schuhe und Taschen von Prada, Tod’s und Chanel. Das sei ihr gutes Recht, sagte Marogna, als sie verhaftet wurde, sie habe schliesslich dafür gearbeitet.
Aber hat sie das tatsächlich? Oder war sie am Ende Beccius «dama», wie manche glauben, seine Geliebte? Fittipaldi mahnt zur Vorsicht, oft seien vatikanische Geschichten in Wahrheit ganz anders, als man denke. «Ich habe mal zwei Monate lang an einem Scoop gearbeitet, bis ich merkte, dass ein Kardinal die Geschichte von A bis Z erfunden hatte, um einem Rivalen zu schaden.» Alle Akten waren gefälscht, für den Abfalleimer.
Äusserst unwahrscheinlich kommt ihm jetzt auch eine These vor, die in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht hat, es ist eine unerhörte Vermutung. Becciu soll Zeugen dafür bezahlt haben, dass sie sich als Missbrauchsopfer ausgaben im Prozess gegen seinen grossen Rivalen, den australischen Kardinal und früheren Präfekten im Wirtschaftssekretariat, George Pell. Um ihn auszuschalten. Man muss sich das mal vorstellen, es wäre der grösste Skandal von allen, Sloane Avenue hoch zehn. «Bisher gibt es aber keine Beweise dafür», sagt Fittipaldi. «Nichts, gar nichts.» Im Vatikan gibt es Stimmen, die behaupten, die Entourage von Pell habe die These in die Welt gesetzt, um sich zu rächen. Er mache bei diesen Spekulationen nicht mit, sagt Fittipaldi. Und tut es damit doch.
Ihm sind schon viele Scoops gelungen, belegt mit Fakten und Dokumenten. «Aber Journalistenpreise holt man damit keine in Italien», sagt er und lacht. Wer nicht ständig herunterbete, wie wunderbar dieser Papst sei und Amen, der gelte als Gotteslästerer, als Nestbeschmutzer. Das Charisma von Franziskus nehme viele Kollegen gefangen, sagt Fittipaldi. Und macht sie befangen. «Auf mich wirkt es ja auch.» Es blendet ihn aber nicht bei der Arbeit.
Stadtstaat mitten in Rom
350-Millionen-Euro-Deals mit schillernden Geschäftsmännern: Über der Basilika im Vatikan braut sich etwas zusammen. Foto: Christian Hartmann (Reuters)
Wollte die Händler aus dem Tempel jagen: Papst Franziskus. Foto: Keystone
Im Zentrum des Skandals: Kardinal Becciu. Foto: Reuters
Im Fokus der Kollegen: Journalist Emiliano Fittipaldi. Foto: Imago
«Die Kirche brachte das Geld sofort in die Schweiz.»
Emiliano Fittipaldi
«Wenn du in Rom der Spur des Geldes folgst, landest du immer schnell im Vatikan.»
Emiliano Fittipaldi