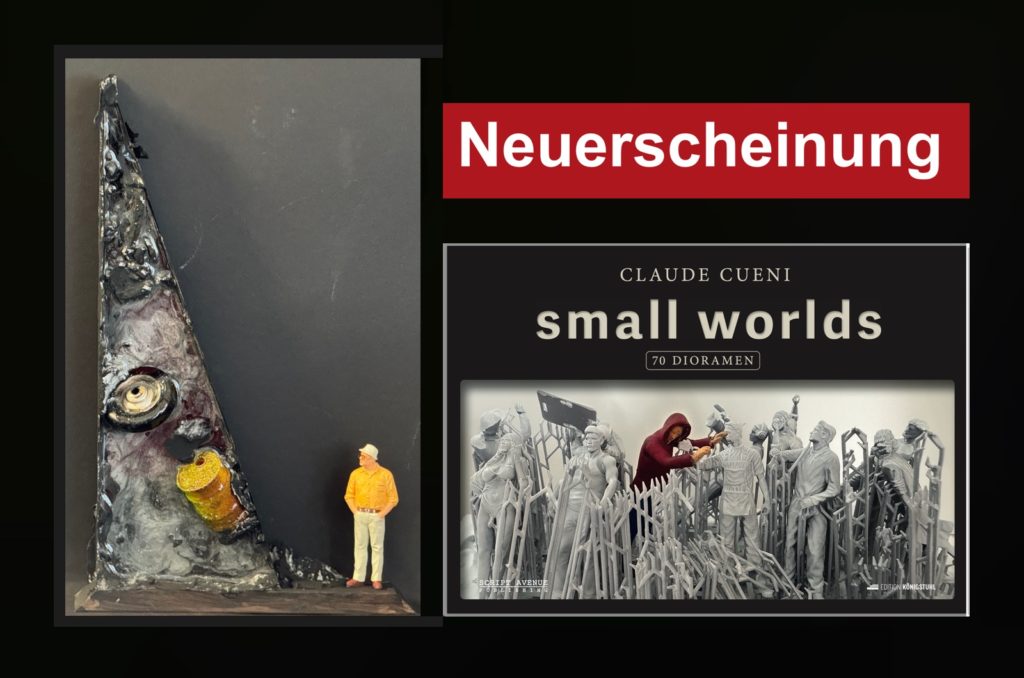Mehr Fantasy, weniger Schneewittchen
Als Kinderzimmer noch nicht aussahen wie Filialen von Franz Carl Weber, war für manchen Dreikäsehoch der vorweihnachtliche Spielzeugkatalog von FCW der Höhepunkt der Festtage. Auch für mich. Obwohl ich wusste, dass ich nichts davon kriegen würde. Wir hatten weder Fernseher noch Auto, an Weihnachten gab es Dinge, die man sowieso hätte kaufen müssen.
Ich schlief im Schlafzimmer meiner Eltern. Unter meinem Bett war eine Schuhschachtel. Darin bewahrte ich alle meine Spielsachen auf: fünf Plastikindianer in roter Farbe. Für sie erfand ich täglich neue Geschichten. Das weckte im Laufe der Jahre mein Interesse für Geschichte, und ich begann auf dem Küchenboden historische Konflikte nachzuspielen.
Die Schlacht von Alamo endete bei mir erst nach Abschluss der Primarschule. Bei Weltstar Phil Collins dauerte der texanische Unabhängigkeitskrieg etwas länger. Schauplatz war bis 2014 nicht Texas, sondern seine 27-Millionen-Villa am Genfersee. Bis zu seiner Scheidung liess Collins täglich David Crockett (1786–1836) seine Kentucky Rifle Old Betsy nachladen. Sein Diorama beanspruchte einen ganzen Saal. Collins gilt heute als einer der grössten Sammler von historischen Spielfiguren.
2012 publizierte er «The Alamo and Beyond: A Collector’s Journey», ein 416-seitiges Werk, das seine Obsession für die Schlacht von Alamo beschreibt. Seine Sammlung ist mittlerweile «tens of millions of dollars» wert. Der heute 73-Jährige trennte sich von drei Ehefrauen, aber nie von David Crockett. Mit ihm und seinen Getreuen zog er nach Miami und vermachte seine Sammlung dem Alamo-Museum in San Antonio, Texas. Auch George R. R. Martin, Autor von «Game of Thrones», hat für seine Romanfiguren und Burgen ein Zimmer eingerichtet. Tausende von Rittern und Fantasiefiguren sind in Vitrinen ausgestellt. Regisseur Peter Jackson («The Lord of the Rings», «The Hobbit») sammelt seit Kindsbeinen Spielfiguren und produziert mittlerweile eine eigene Serie mit den Charakteren aus seinen J.-R.-R.-Tolkien-Filmen.
Nicht wenige Autoren haben in ihrer Kindheit die ersten Storys mit billigen Plastikfiguren inszeniert, eine nicht zu unterschätzende kreative Herausforderung, wenn man täglich mit der fast immergleichen Anzahl Figuren neue Plots entwickelt. Einige unter ihnen sind heute anspruchsvolle Sammler. Sie krabbeln nicht mehr auf dem Teppichboden herum, sondern erfreuen sich an Kindheitserinnerungen, die sie in Vitrinen ausstellen.
Nicht so H. G. Wells (1866–1946). Der britische Schriftsteller gehörte seit seinem Welterfolg «Der Krieg der Welten» zu den Pionieren der Science-Fiction-Literatur. Wie alle Kreativen hegte und pflegte er das kleine Kind in sich und lud auch im Erwachsenenalter seine Kumpels zum Spielen ein. Aber nach Regeln, die der Historiker und Soziologe 1913 in seinem Buch «Kleine Kriege» erläuterte. Was sich der bekennende Pazifist da ausgedacht hatte, erfuhr siebzig Jahre später unter der Bezeichnung «Warhammer Fantasy Battle» einen regelrechten Hype. In diesem sogenannten Tabletop-Spiel kämpfen nicht Briten gegen Zulus, sondern Drachen, Zauberer, Elfen und Zwerge. Magie statt Historie. Eine Schachvariante mit mehr als 32 Figuren.
Figürliche Darstellungen von Tieren und Menschen gab es bereits vor 40 000 Jahren. Die Venusfigur von Willendorf wird auf 30 000 Jahre v. Chr. datiert, der Löwenmensch von Hohlenstein-Stadel ist aus Mammutelfenbein und gar 10 000 Jahre älter. Die Figuren unserer frühen Vorfahren waren aus Holz, Knochen, Ton oder Stein, wobei man sich bei einzelnen Objekten nicht einig ist, ob es sich um kultische Objekte oder Spielzeug handelt.
Im Mittelalter wurden Spielfiguren geschlechtsspezifischer und dienten auch dazu, die Kinder der Adligen auf ihre spätere Rolle vorzubereiten: Buben erhielten Ritterfiguren, Mädchen Puppen. Die meisten Kinder mussten jedoch mit dem spielen, was die Natur hergab. In vielen Ländern ist das heute noch so.
Nach dem Siebenjährigen Krieg (1756–1763) wurden Zinnsoldaten aus Weissmetall populär, Mit Aufkommen des Bürgertums entstanden erste Werkstätten, die solche für den Nachwuchs des neuen Mittelstands produzierten. Noch waren es klumpige Soldaten aus Metall. Aber für kleine Militärstrategen waren sie gut genug, für grosse sowieso. Sie benutzten sie, um ihren Offizieren auf einer Landkarte die Standorte der gegnerischen Truppen aufzuzeigen.
William Britain läutete 1893 mit dem Hohlgussverfahren eine neue Ära ein. In Deutschland kneteten die Gebrüder Otto und Max Hausser Figuren aus Sägemehl und Leim und verstärkten sie innen mit einem Draht. Was im Kinderzimmer Spiel war, wurde für Max Realität. Er fiel 1915 als deutscher Soldat an der Westfront. Sein Bruder Otto machte allein weiter und produzierte in den 1930er Jahren jährlich drei Millionen Hausser-Elastolinfiguren.
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs besetzten Hitler und Co. die Verkaufsregale. Sie hatten Porzellanköpfe, um den Erkennungswert zu steigern. Nach Kriegsende wurden die kleinen Goebbels und Görings aus den Regalen verbannt, mancher SS-Scherge fiel zu Hause diskret Mutters Staubsauger zum Opfer. Nazis, das waren nachträglich nur die andern.
Otto Hausser zog der Wehrmacht die Porzellanköpfe wie der Zahnarzt die Weisheitszähne. Er ersetzte sie durch neutrale Häupter. Die Uniformen wurden mit den Farben der Schweizer Armee übermalt, und Hausser widmete sich unverfänglichen Themen: Winnetou statt Hitler, Bauernhof statt Adlerhorst.
Es waren wiederum technologische Innovationen, die mit Beginn der 1970er Jahre das goldene Zeitalter der toy soldiers einläutete. Da nun verschiedenfarbige Kunststoffteile in einem einzigen Arbeitsgang zu einer Figur gepresst werden konnten, entfiel die teure Handbemalung.
Den Weltmarkt dominierten britische Firmen wie Britains, Airfix und Timpo Toys. In den USA produzierte Marx, in Frankreich Starlux, in Italien Atlantic und in Spanien Reamsa. Hausser-Elastolin verpasste sowohl den technologischen Fortschritt als auch die Zeichen der Zeit: «Make love not war» und «Give peace a chance». Als die US-Armee die ersten Napalm-Bomben über Vietnam abwarf und Millionen gegen den Krieg protestierten, kam erneut Mutters Staubsauger zum Einsatz. Nur Farmtiere überlebten.
Erst in den 1980er Jahren gelang den kleinen Sheriffs dank dem PC eine digitale Auferstehung. Der Wilde Westen wurde ins Weltall gebeamt, und Roboter waren die neuen Ritter. Das war das Aus für Plastiksoldaten, aber die mittlerweile erwachsenen Kinder behielten ihre Faszination für historische Figuren bei.
Der Markt erkannte die Nachfrage und begann mit der Produktion von bemalten Metallfiguren in matten Acrylfarben. Man nennt sie«historical model miniatures», weil sie im Gegensatz zu den billigen Plastiksoldaten historischen Ansprüchen genügen und nicht mehr ausschliesslich militärisch ausgerichtet sind.
Zu den prominenten Herstellern gehören seit 1946 «Les Drapeaux de France» an der Pariser Place Colette, doch auch im Osten ringen ukrainische und russische Jungunternehmer mit ihren 54 Millimeter grossen Metallfiguren um Marktanteile. Die Rohlinge kaufen sie in Italien und bemalen sie in ihren Werkstätten. Die Kundschaft besteht fast ausschliesslich aus gutverdienenden Männern über 35, darunter Geschichtsprofessoren, Chirurgen und Politiker aus aller Welt. Normalverdiener zwischen Moskau und Kiew können sich diese historischen Modelle kaum leisten.
Während ein kleines Diorama mit vier Schweizer Söldnern in Museumsqualität 4576 US-Dollar kostet, bezahlt man für einen Minnesänger 612 US-Dollar. Die gleichen Figuren bieten die Ostfirmen auf Ebay und anderen Plattformen zum halben Preis an und gewähren dann erneut einen Rabatt. Übertreibungen und Pathos gehören nun mal zur russisch-ukrainischen DNA. Die mit Abstand meistverkauften Figuren findet man nicht in den Online-Katalogen: Es sind Nazis. Die Käufer: Amerikaner und Deutsche. Am beliebtesten ist die Figur Rommel.
Rund 7500 Kilometer entfernt betreibt ein ehemaliger Royal Marine ein ähnliches Geschäft. Der Schotte Andy C. Neilson, ein ehemaliger Marine Commander, gründete 1983 in Hongkong mit seiner Freundin Laura MacAllister Johnson die Firma King & Country. Als ich 2009 nach einem Kinobesuch in der Shoppingmall Pacific Place per Zufall seinen Laden sah, war er lediglich Shop 245. Im Schaufenster hatte er schöne Dioramen mit traditionell gekleideten chinesischen Figuren ausgestellt. Nebst Themen wie «The Streets of Old Hong Kong» bot er auch Serien wie «Howard Carter, 1922» oder «World of Charles Dickens in Old London» an.
Zum Sortiment gehörten die üblichen Klassiker: Antike, Mittelalter, Wildwest, amerikanischer Bürgerkrieg und die beiden Weltkriege. Für seinen gallisch-keltischen Arverner Vercingetorix benutzte er die Statue in Alise-Sainte-Reine, für seine Figur «Loyalistischer Soldat im Moment des Todes» (1936) die Fotografie des Kriegsreporters Robert Capa (1913–1954). Ausführliche Begleittexte erläuterten jeweils den historischen Kontext.
Heute verkauft Neilson jährlich über 25 000 Figuren, was einem Umsatz von rund 1,5 Millionen US-Dollar entspricht. Geld genug, um in Texas und Hongkong weitere Shops zu eröffnen. Heute hängt eine Texttafel im Schaufenster. Er distanziert sich vom Nationalsozialismus. Nicht ohne Grund. Denn als ich damals in Hongkong seinen Laden betrat und mich etwas genauer umsah, wähnte ich mich plötzlich in einem Shop für Nazifiguren. Im hinteren Teil des Geschäfts marschierten SS-Soldaten, Hitlerjugend und Hitler in vierzehn verschiedenen Posen. In seinem umfangreichen Online-Katalog ist die deutsche Wehrmacht krass übervertreten. Angesichts der hinlänglich dokumentierten Naziverbrechen mehr als irritierend. Die Texttafel ist den Beanstandungen von Touristen aus dem Westen geschuldet, denn in Asien waren vor nicht allzu langer Zeit Shops und Kleiderlinien mit dem Namen «Hitler» gebrandet.
Die deutschen Kleinkunstwerkstätten Paul M. Preiser GmbH gehören mit über 10 000 unterschiedlichen Figuren zur bevorzugten Adresse jener, die für ihre heilen Welten im Massstab 1:87 Personal suchen. Die Detailtreue der Rohlinge und die sorgfältige Bemalung der Miniaturfiguren sind hohe Kunst. Im Angebot sind auch die Elastolinmodelle der ehemaligen Firma Hausser, die im Sommer 1983 Konkurs ging und damals von Preiser übernommen wurde. In ihrer im Buchhandel erhältlichen Firmengeschichte «Preiserfiguren zum Verlieben schön» wird jedoch weder die Übernahme von Hausser-Elastolin erwähnt noch die weiterhin produzierten Wehrmachtsfiguren. Dafür bietet man neuerdings gleichgeschlechtliche Paare, weibliche Figuren mit rubenschen Formen und People of Color an.
Die grösste Sammlung «kleiner Menschen» bietet mit über 200 000 Preiserfiguren das Hamburger Miniaturwunderland. Als sich herumsprach, dass die vom Betreiber kreierten Sexszenen die meistfotografierten Sujets sind, produzierte die Firma Noch, Preisers grösster Konkurrent, eine Serie mit Sexszenen in verschiedenen Posen. Preiser zog widerwillig nach, ein bisschen wenigstens, denn ihre Erotiklinie wird ausschliesslich von ihrer Tochtergesellschaft Merten angeboten.
Dank neuen Kunststoffen und technischen Innovationen bringt der 3-D-Printer seit den 1990er Jahren neue Impulse. Junge Unternehmer, meist Paare mit akademischer Ausbildung, designen 3-D-Modelle am Computer und lizenzieren sie an Firmen wie 3Drifter-Miniatures in Bonn oder Germania-Figuren in Duisburg. Was früher römischen Imperatoren vorbehalten war, ist für selbstverliebte Hardcore-Individualisten schon heute möglich: ein 3-D-Selfie fürs Bücherregal.
Die fortschreitende Fragmentierung der Gesellschaft findet auch in der Käuferschaft von Miniaturfiguren statt. Es gibt Kinder und Jugendliche, die Dinos, Monster, Fantasy- und Comicfiguren vorziehen, es gibt die Betreiber von Modelleisenbahnen, die 08/15-Figuren im Massstab 1:87 (ca. 2 cm) kaufen. Historisch Interessierte sammeln Modelle für die Vitrine, Künstler brauchen Personal für ihre Dioramen, Tabletop-Player rekrutieren Echsen, Drachen und Turtles fürs Schlachtfeld, und Vintageliebhaber suchen Werbefiguren aus ihrer Kindheit.
Die 40 000-jährige Geschichte der figürlichen Darstellungen ist ähnlich wie die Geschichte der Mode, der Toiletten, der Medizin oder der Schönheitsideale ein Spiegel der Epoche, des Zeitgeistes und der technischen Innovationen. Heute konkurrenzieren Fantasiewelten die realistischen Figurensets von früher. Auch Puppen folgen dem Trend. 2010 stürzten die Monster-High-Puppen von Mattel mit einem Jahresumsatz von einer halben Milliarde die braven Barbiepuppen ins Land der Tränen. Nach einem kurzen Taucher erleben die Monster nun ein Comeback und teilen sich in der vorweihnachtlichen Zeit die Regale der Spielwarengeschäfte.
Ob der Trend der zunehmenden Realitätsverweigerung der westlichen Gesellschaft geschuldet ist, sei mal dahingestellt. Ein Blick in die Weihnachtskataloge bestätigt den Trend: Man setzt auf eingeführte Brands der Film- und Game-Industrie: mehr Fantasy und Horror, weniger Bauernhof und Schneewittchen.