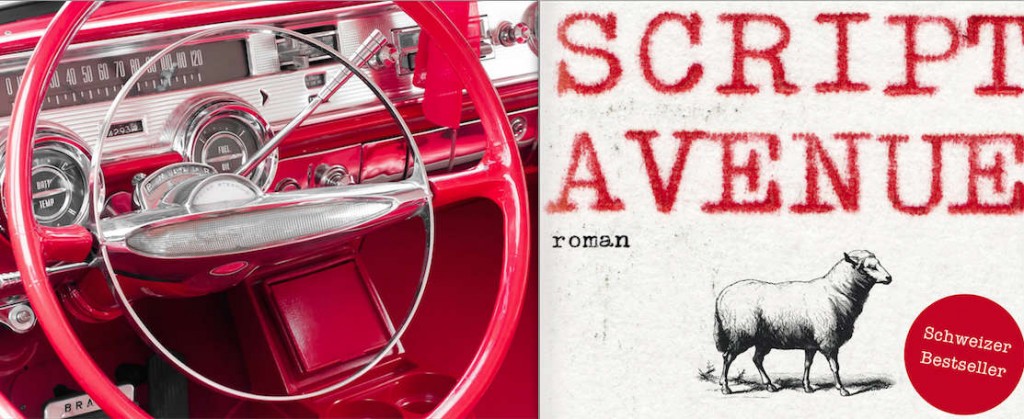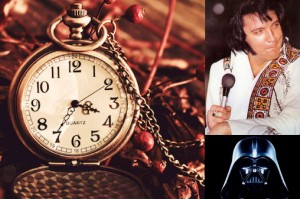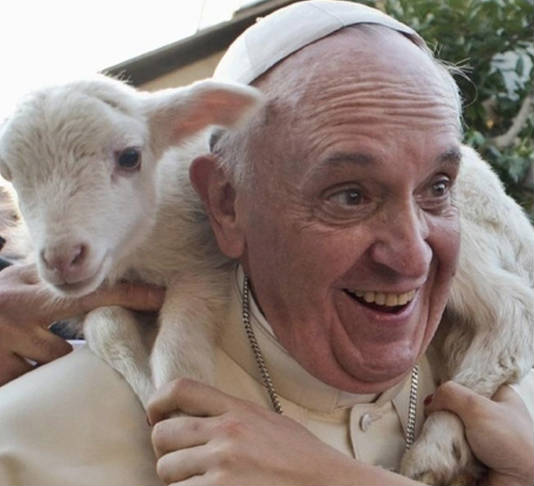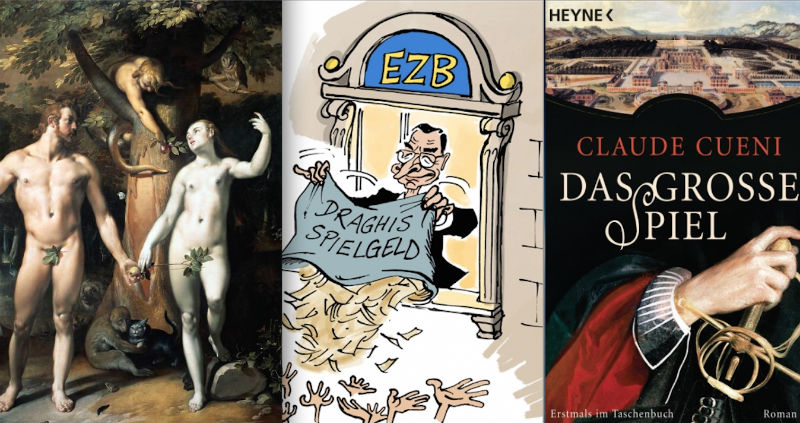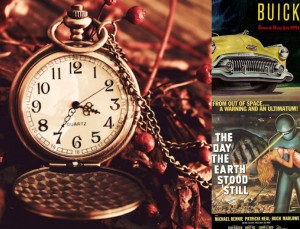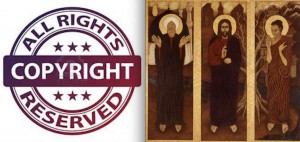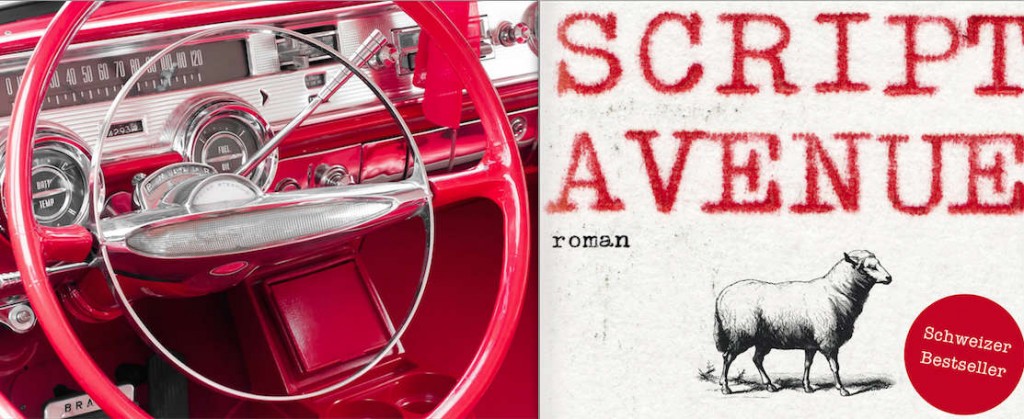 Interview: Dante Andrea Franzetti, Interessen.org, Wochenmagazin für Kultur und Politik.
Interview: Dante Andrea Franzetti, Interessen.org, Wochenmagazin für Kultur und Politik.
Interessen.org: Wie viel ist autobiographisch an Ihrer Autobiographie? Die Frage ist weniger bizarr, als es scheint: „Script Avenue“ ist sehr ausgeschmückt und ausgeblümt, und Sie nennen das Buch einen „Roman“.
Claude Cueni: Ich habe das Buch als Roman angeboten, weil es mir peinlich gewesen wäre, es als Autobiographie zu bezeichnen. Ich bin ja keine Berühmtheit. Aber mein Agent und meine Verlegerin Gaby Baumann meinten, das sei eine Autobiographie. Diese Genrebezeichnung war für mich auch aus juristischen Gründen nicht sinnvoll. Wir haben uns dann rasch auf „Roman“ geeinigt.
„Die Script Avenue“, das ist mein Leben, selbst Dialoge aus den 60er Jahren konnte ich eins zu eins abrufen. Wenn ich mich erinnere, sehe ich Filme, und wenn ich schreibe, kann ich diese Filme abrufen.
Gibt es diesen Onkel Arthur, Fremdenlegionär, der sich in Algerien vor an Panzerrohren baumelnden, abgehackten Köpfen fotografieren liess, tatsächlich? Wie andere Personen, etwa der marxistische Schriftsteller Berthold Krenz, scheint er eher eine Kunstfigur.
Es gibt keine Kunstfiguren in der „Script Avenue“. Der reale „Onkel Arthur“ wohnt heute in Basel, aber ich habe ihn seit schätzungsweise zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Und bin froh darüber. Das Panzerfoto mit dem Totenschädel hat mich damals als Bub schockiert und ist mir deshalb in lebhafter Erinnerung geblieben. Diese Figur ist eins zu eins aus der Realität übernommen, die Dialoge, die Prügeleien, die Vergewaltigungen, die Erzählungen über die Fremdenlegion in Algerien, einfach alles. Ich habe nur den Vornamen ausgewechselt.
Auch der marxistische Schriftsteller Berthold Krenz ist keine Kunstfigur. Viele Dialoge sind Originaldialoge aus der damaligen Zeit an den jeweiligen Schauplätzen.
Die erste Fassung hatte 890 Seiten und die richtigen Namen und Ortsangaben. Diese habe ich dann nach dem juristischen Lektorat verfremdet. Sie werden das jurassische Dorf „Vilaincourt“ auf keiner Karte finden, denn es ist „Boncourt“. Ich habe ein Wortspiel aus „vilaine court“ (hässlicher Hof) und „bonne court“ (guter Hof) bzw. Boncourt gemacht.
Ihre Memoiren, oder wie man es nun nennen will, zeichnen sich durch Ironie und Sarkasmus, barocke Fülle und einen souveränen distanzierten Stil aus. Die Stimmlage ist ein Ton höher, schriller als in Ihren übrigen Büchern. Kann man nur als eine Art Simplizissimus über sich selbst schreiben?
Ich bin wohl von klein auf so programmiert, dass ich überall die Ironie des Schicksals oder die Komik des Alltags erkenne. Auch der Rückblick auf mein merkwürdiges Leben konnte deshalb nicht frei von Ironie sein. In jedem Leben steckt eine Menge Pulp Fiction.
Feinfühlig, aber auch nüchterner sind Ihre an Krebs verstorbene Frau und Ihr Sohn dazwischengeschaltet. Es sind die einzigen, die vom Sarkasmus des Erzählers ausgenommen sind. Verbat sich hier die Ironie?
Der Tod meiner Frau war ein monumentales Ereignis, ein Crashkurs in Philosophie. Das Leid war so, dass keine Ironie aufkommen kann. Über meinen Krebs kann ich Witze reissen, aber nicht über den Krebstod meiner Frau.
Es taucht aber auch ein ominöser Literaturagent auf, der u.a. die Schwierigkeiten der Publikation dieses Buches schildert. Waren kritische Bemerkungen über die arabische Kultur das Problem? Oder Ihre Weigerung, den Feminismus als Gottes Segen zu verstehen?
Meinem Agenten verdanke ich den internationalen Erfolg meiner historischen Romane. Er hatte kein Problem mit dem Mangel an Political Correctness. Er hielt den Roman einfach für unverkäuflich, weil er weder Roman noch Autobiographie, weder Tragödie noch Komödie ist. Er meinte, ich müsste mich für ein Genre entscheiden, sonst könne er das Buch nicht anbieten. Die erste Frage eines Verlegers sei immer: Welches Genre? Aber ich wollte ganz bewusst ein Buch schreiben, das alles vereint, was das Leben ausmacht: Komödie und Tragödie, eine Schweizer Forrest-Gump-Geschichte.
Glauben Sie, dass die Reaktion der Verlage nach den Massakern in Paris eine andere gewesen wäre – in dem Sinne: Unsere Selbstzensur muss jetzt ein Ende haben? Oder ist es umgekehrt: Kuschen wir alle noch mehr vor den Geboten der PC?
Der Buchmarkt zeigt, dass alles möglich ist. Bei Grossverlagen entscheidet am Ende der finanzielle Aspekt und nicht die Political Correctness. Die Selbstzensur haben sich eher die Kulturschaffenden auferlegt. Intellektuelle sind es gewohnt, mit Worten zu kämpfen. Stehen sie plötzlich einem primitiven Kerl gegenüber, der mit roher Gewalt droht, überlegt sich ein Autor oder Karikaturist zweimal, ob sich das Risiko wirklich lohnt. Ein Kulturschaffender im Westen hat mehr zu verlieren als ein religiöser Fanatiker ohne Bildung und berufliche Perspektive.
Ist es bezeichnend für unsere Zeit, dass wir wieder mehr um die Freiheit der Kunst kämpfen müssen?
Die Freiheit der Kunst muss täglich verteidigt werden, sonst verliert man sie. Das war schon in der Antike so. Honoré Daumier wanderte 1832 wegen seiner Gargantua-Karikatur ins Gefängnis. Als 1951 die „Sünderin“ mit Hildegard Knef aufgeführt wurde, stürmte ein katholischer Priester mit Gleichgesinnten die Kinos und warf Stinkbomben und weisse Mäuse in den Saal, 1963 wurde vor den Theatern gegen die Aufführung von Rolf Hochhuts „Stellvertreter“ demonstriert. Kontroversen wird es immer geben, das gehört zur Entwicklung einer Gesellschaft, aber heute sind die Skandale oft gesucht und Teil der Marketingkampagne.
Es gibt zweifellos einige Stellen im Buch, die Rechtspopulisten gefallen würden: zum Beispiel, dass unser Staat Pädophilen erlaubt, mit Kindern zu arbeiten; oder Afrikaner, die in der Bronzezeit lebten und „vor dem Penaltyschiessen Schimpansenknochen unter der gegnerischen Trainerbank kreuzen“. Die Schweiz sei ein Land, in dem Leistung „ein Offizialdelikt“ sei. Soll das schockieren? Und wen?
Dass man rechtskräftig verurteilten Pädophilen nicht mehr erlaubt, mit Kindern zu arbeiten, finde ich als liebender Vater selbstverständlich. Dass wir verwöhnte Wohlstandsbürger geworden sind, diese Einschätzung ist nicht eine Frage der Ideologie, sondern des Alters. Im Alter kann man vergleichen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, ging man nicht in die Ferien. Heute darf man in den Medien jammern, wenn man nicht zweimal im Jahr Urlaub machen kann.
Wenn Sie die Dritte Welt gesehen und realisiert haben, dass eine Milliarde Menschen in Slums wohnen, kommen Sie zum Schluss, dass wir jede Verhältnismässigkeit verloren haben. Auch diese Einschätzung hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit dem Wissen über die katastrophale Armut in der Dritten Welt.
Zu den Schimpansenknochen noch ein Wort: Ich bin an einem Freitag den 13. geboren und habe für Aberglauben nur Spott übrig. Meine Mutter kreuzte manchmal zwei Küchenmesser unter meinem Bett, um mich davon abzuhalten, Sartre oder Henry Miller zu lesen. Ich kann heute noch herzhaft darüber lachen. Wieso darf ich nicht auch darüber lachen, wenn ein Afrikaner zwei Schimpansenknochen unter der gegnerischen Trainerbank kreuzt? Die Fussballwelt ist voller abergläubischer Menschen. Die meisten Menschen sind abergläubisch. Auch Religion ist eine Form von Aberglauben.
Ihr Urteil über die Schweizer Literatur und Kritik der letzten Jahrzehnte ist vernichtend: langweilig, sozialdemokratisch, brav, uninspiriert, Gesinnungsliteratur usw. Trifft es Sie, dass das Feuilleton Sie sozusagen als gehobenen Trivialautor betrachtet?
Ich habe doch nichts gegen sozialdemokratische Literatur. Ich bin eh ein Freund von Meinungsvielfalt und freier Meinungsäusserung. Ich mag jene Art Literatur nicht besonders, die in pastoralem Ton belehrt und bekehren will. Für Botschaften soll man bekanntlich die Post benützen. Ich will Geschichten erzählen mit Charakteren, die berühren und nachhaltig wirken, ich schreibe Historie in Romanform, zeige, dass Wissen sexy ist. Als „Trivialliteratur“ sind meine historischen Romane noch nie bezeichnet worden, meistens wählt man „intelligente Unterhaltung“. Was soll daran schlecht sein?
Es ist anspruchsvoll, einen historischen Roman wie „Das grosse Spiel“ zu recherchieren und zu schreiben, der die Erfindung des Papiergeldes in Europa dramatisiert und richtig Spass macht. Sie kennen sicher das Zitat: Jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur nicht die langweilige. Wir leben in einem freien Land, jeder soll schreiben, was er mag, und jeder soll lesen, was er mag.
Weite Strecken von „Script Avenue“ lesen sich wie eine nostalgische Hymne auf die 70er Jahre. Nie wieder, heisst es, würden wir eine solche Freiheit erleben. Was hat sich verändert?
Alles. Die 70er Jahre waren wilder, frecher, schräger, unkonventioneller, erotischer. Eine Janis Joplin lebte ihre Songs auf der Bühne, ein Joe Cocker litt an seinen Songs, Song und Sänger waren eins. Heute haben wir eine singende „Arsch- und Tittenkultur“, Medienstars wie Paris Hilton oder Kim Kardashian sind berühmt für ihr Berühmtsein. Stars werden nicht mehr geboren, sondern künstlich erschaffen. Und das Ganze sieht dann eher aus wie ein Werbespot für Badeschaum.
Aber das ist okay, jeder nach seinem Geschmack. In den 70er Jahren gab’s einfach weniger Bürokratie, Reglementierungen, Bevormundungen, mehr originelle Typen, schräge Filme, weniger Political Correctness. Es war nebst der Belle Epoque das geilste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.
Die Zeichnung der 70er Jahre ist aber auch ambivalent: Es sei das Zeitalter gewesen, in dem Leute Geld ohne Leistung gefordert hätten. Kann man sagen: Sie stehen fest auf dem Boden der freien Marktwirtschaft?
Dieses Zitat bezieht sich nicht auf die 70er Jahre, sondern auf die Gegenwart. Aber zu Ihrer Frage: Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft, in der Leistung honoriert, aber die Schwächsten der Gesellschaft beschützt und unterstützt werden. Keine einzige Partei setzt sich heute für Behinderte ein. Ich bin auch für ein Maximum an individueller Freiheit, solange sie die Freiheit anderer nicht einschränkt. Aber Marx hatte absolut Recht, als er schrieb: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“.
Ich wollte als Kind immer „weniger Vater“, als Erwachsener wünschte ich mir „weniger Staat“, als junger Autor lebte ich wie ein Bohemien und war prädestiniert, ein Big Lebowski zu werden. Doch Schicksalsschläge zwangen mich, meine Interessen zurückzustellen und sehr viel zu arbeiten. Ich musste ein Leben lang als Einzelkämpfer viel Leistung erbringen. Ich war und bin deshalb ein Freund von Selbstverantwortung und Verantwortung anderen Menschen gegenüber.
Schon in „Das grosse Spiel“, einem Roman über den Papiergeld-Erfinder John Law, ist Ihr Gespür für Dramaturgie offensichtlich. Dramaturgie ist grundsätzlich an Fiktion geknüpft, das wahre Leben kennt viele Leerstellen, Wiederholungen, Langeweile etc. Wie liessen sich die Erfordernisse der Autobiographie und der Dramaturgie überhaupt zusammenbringen?
Das war relativ einfach. Stellen Sie sich vor, mein Leben besteht aus einem Becher Popcorn. Sie suchen gezielt einige interessante Popcorns aus und reihen sie nach dramaturgischen Gesichtspunkten auf dem Tisch aneinander. Das ist dann die Script Avenue. Nach der ersten Fassung von 890 Seiten habe ich alles gestrichen, was in meinem Leben zwar wichtig, aber für den Roman langweilig war. Es gibt’s nichts Langweiligeres, als wenn der Nachbar detailliert über seine Ferien auf Mallorca erzählt. Das Leben wird mit den Jahren in der Tat ein bisschen repetitiv, der 3429. Orgasmus ist nicht mehr so aufregend wie der erste.
Wäre der Begriff Autofiktion auf „Script Avenue“ anwendbar? Dramatisierung des eigenen Lebens?
Ja, Karl Ove Knausgård schreibt auch Autofiktion, aber er hat trotzdem eine Menge Klagen am Hals. (Karl Ove Knausgård, 1968, norwegischer Schriftsteller, schrieb den Romanzyklus mit dem etwas irritierenden Titel „Min Kamp“, der unter anderem eine Abrechnung mit dem Vater ist – die Red.)
Sie sind schwer krank. Schärft diese Lage den Blick? Macht sie freier gegenüber Konventionen? „Script Avenue“ atmet eine eindrückliche, geradezu meisterhafte – verzeihen Sie die Direktheit – Souveränität des Sterbenden.
Ich musste mich in den letzten fünf Jahren zweimal damit abfinden, dass ich in den nächsten Wochen sterbe. Das verändert alles. Ich lebe im Bewusstsein, dass es nächste Woche schon zu Ende sein kann. In dieser Situation wird man sehr bescheiden, demütig und schreibt ehrliche Bücher ohne Rücksicht auf die eigene Reputation.
Das ist wohl die Stärke der »Script Avenue«. Nach solchen existentiellen Erfahrungen wird man auch gelassener, vielleicht sogar gleichgültiger, und beschreibt die Dinge, wie man sie sieht, und nicht, wie man sie gerne sehen möchte, oder wie erwartet wird, dass man sie sieht. Man ist »signed off«. Das Phänomen habe ich in Hongkong oft beobachtet. Gestrandete Expats, die sich abseits ihres Kulturkreises einen Deut um ihre Reputation kümmern.
Mir geht es heute ähnlich. Ich bin wie ein Ausserirdischer, der nicht mehr Teil dieser Gesellschaft ist. Mein Koffer ist gepackt. Aber ich freue mich dennoch jeden Tag, ab drei Uhr morgens auf dem iPad Zeitungen zu lesen und einmal die Woche im Donati meine „Scaloppine Purgatorio del Padrone“ zu essen, ich muss ja nicht mehr fürs Alter sparen.
Zuletzt zur Schweiz: Es ist ein buntes Land, das Sie schildern, voller schräger Vögel, die man kaum noch antrifft. Heute scheint dieser Kleinstaat ohne Impulse, kraftlos, geistig verarmt, belanglos, konformistisch und desorientiert. Oder würden Sie diesem Eindruck widersprechen?
Ich habe auf so vielen Hochzeiten getanzt, dass ich einer Unzahl schräger Vögel begegnet bin. Die gibt es immer noch, sie leben mitten unter uns, aber sie gewähren einem nur dann Einblick in ihre Seele, wenn man ihnen in einem ersten Schritt mit schonungsloser Offenheit entgegentritt. Sie würden nicht glauben, wie viele schräge Vögel ich durch die Script Avenue kennengelernt habe. Meine Offenheit hat sie animiert, mir sehr Intimes und Bewegendes zu mailen. Viele Menschen haben ihre eigene Script Avenue. Aber sie lassen nur selten jemanden hineinschauen.
Zu unserem Kleinstaat: Viele Leute wachsen wie Prinzen und Prinzessinen heran, die permanente staatliche Rundumversorgung macht sie am Ende lebensunfähig, apathisch, aber auch unzufrieden und unglücklich. Aber es gibt auch einen Teil der Jugend, der Chilli im Hintern hat und etwas aufbauen und erreichen will. Jede Epoche hat ihre eigene Tinte, und die Erde dreht sich weiter.
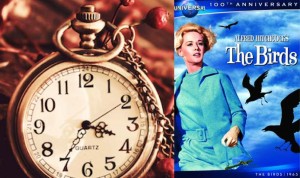 1963 schluckte die State Mutual Insurance Company einen Konkurrenten und wollte die Übernahme mit einem freundlichen Gesicht visualisieren. Der Freelancer Harvey Ball entwarf in zehn Minuten einen gelben Kreis mit zwei fröhlichen Augen und einem lächelnden Mund. Für seinen «Smiley» erhielt er 45 Dollar und eine Menge Ärger. Jahrelang kämpfte er mit seinen Anwälten vor Gericht, damit seine Urheberschaft anerkannt wird. Nach 40 Jahren erfolglosem Prozessieren war selbst dem Schöpfer des Smiley das Lächeln vergangen. Seine Kreation ist heute die meistverbreitete Werbegrafik der Welt.
1963 schluckte die State Mutual Insurance Company einen Konkurrenten und wollte die Übernahme mit einem freundlichen Gesicht visualisieren. Der Freelancer Harvey Ball entwarf in zehn Minuten einen gelben Kreis mit zwei fröhlichen Augen und einem lächelnden Mund. Für seinen «Smiley» erhielt er 45 Dollar und eine Menge Ärger. Jahrelang kämpfte er mit seinen Anwälten vor Gericht, damit seine Urheberschaft anerkannt wird. Nach 40 Jahren erfolglosem Prozessieren war selbst dem Schöpfer des Smiley das Lächeln vergangen. Seine Kreation ist heute die meistverbreitete Werbegrafik der Welt. «Ich will den War Room sehen», sagte der frisch gewählte amerikanische Präsident Ronald Reagan, als er zum ersten Mal das Weisse Haus betrat. Man musste ihm schonend beibringen, dass der War Room, den er im Kino gesehen hatte, eine Kreation des Bühnenbauers Ken Adams war. Er hatte für die meisten James-Bond-Filme die futuristischen Bunker gebaut. «Bigger than life» war sein Credo.
«Ich will den War Room sehen», sagte der frisch gewählte amerikanische Präsident Ronald Reagan, als er zum ersten Mal das Weisse Haus betrat. Man musste ihm schonend beibringen, dass der War Room, den er im Kino gesehen hatte, eine Kreation des Bühnenbauers Ken Adams war. Er hatte für die meisten James-Bond-Filme die futuristischen Bunker gebaut. «Bigger than life» war sein Credo.